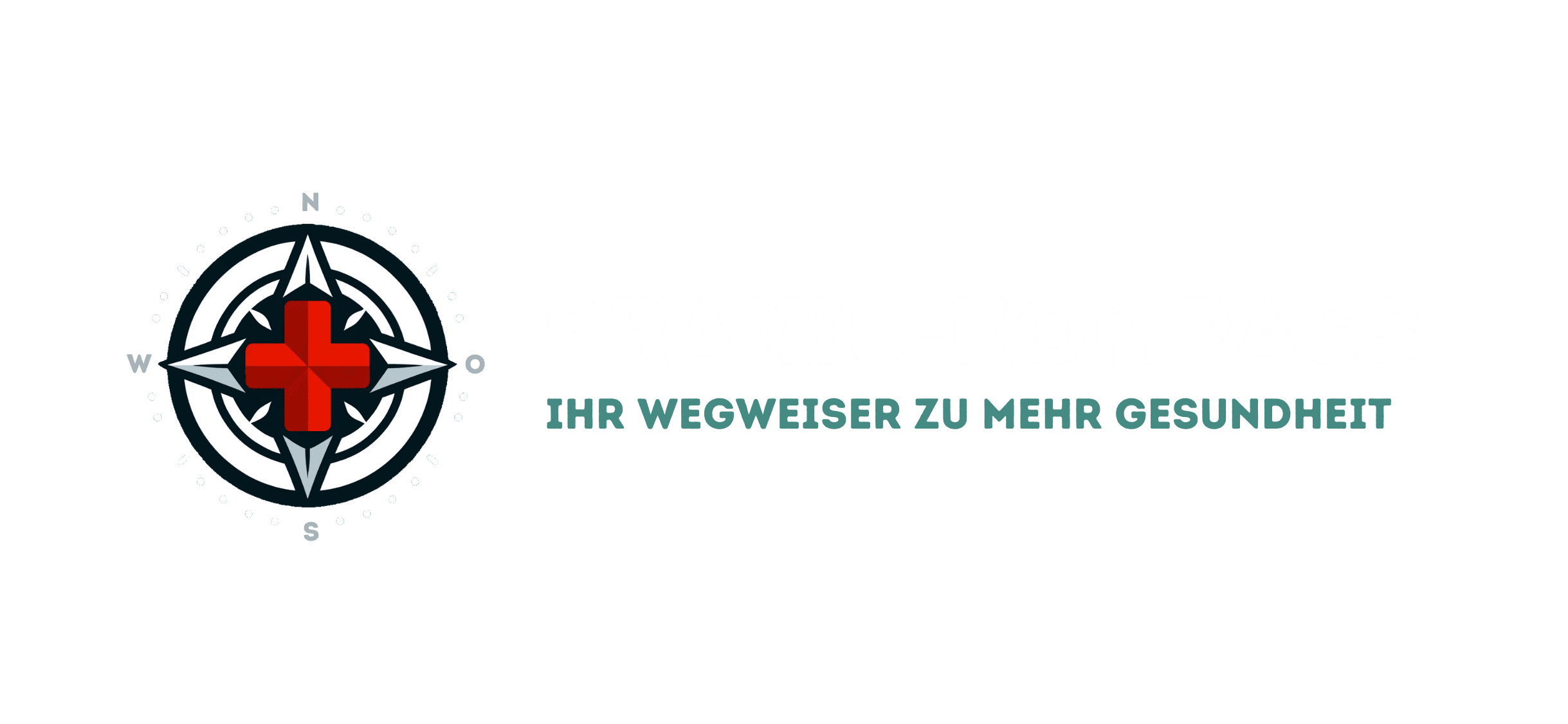Telemedizin ist heute ein fester Bestandteil der deutschen Gesundheitsversorgung.
Online-Sprechstunden sind nach der MBO‑Ä (§ 7 Abs. 4) erlaubt und die BMV‑Ä Anlage 31c (01.03.2025) macht Videosprechstunden zum Regelfall. Gleichzeitig bleiben Mindestsprechstunden vor Ort bestehen.
Der KBV‑Patientenservice 116117 vermittelt seit 2024/2025 telemedizinische Leistungen und Termine nach § 370a SGB V. Das schafft neue Zugänge und klare Prozesse für Patienten und Ärztinnen und Ärzte.
In diesem Guide erhalten Sie kompakte Informationen zu Nutzen, Einsatzfeldern und Abläufen. Wir ordnen digitale Bausteine wie ePA und E‑Rezept in den rechtlichen Rahmen ein und zeigen, wie Digitalisierung die Versorgungsqualität stärkt.
Lesen Sie weiter, um konkret zu erfahren, was das für patienten und jeden Arzt bedeutet — praxisnah, rechtssicher und alltagsorientiert.
Wesentliche Erkenntnisse
- Telemedizin ist integraler Teil der modernen Gesundheitsversorgung in Deutschland.
- Videosprechstunden sind durch neue Regelungen zunehmend zum Standard geworden.
- Der 116117‑Service erleichtert die Online‑Vermittlung telemedizinischer Termine.
- Rechtliche Vorgaben wie MBO‑Ä und BMV‑Ä schaffen Orientierung für Praxis und Patienten.
- Digitale Bausteine (ePA, E‑Rezept) verbessern Zugänglichkeit und Kontinuität der Versorgung.
Telemedizin in Deutschland: Definition, Entwicklung und Nutzen für Patienten und Ärzte
Medizinische Leistungen aus der Distanz verbinden Ärzte, Patient und Daten in neuen Abläufen. Sie ergänzen den Praxisbesuch, ohne die Beziehung zwischen Arzt und Patient zu ersetzen.
Begriffsabgrenzung
Fernbehandlung beschreibt ärztliche Diagnostik und Beratung aus der Ferne. Sie erfolgt häufig asynchron oder telefonisch.
Videosprechstunde ist die synchrone Konsultation per Bild und Ton. Sie eignet sich für Folgebesuche und visuelle Befunde.
Telemonitoring nutzt kontinuierliche Datenübermittlung zur Langzeitbeobachtung chronischer Erkrankungen.
Vorteile in der Versorgung
- Zeitgewinn: Schnellere Termine und kürzere Wege für Patienten.
- Qualität: Standardisierte Anamnese und Checklisten erhöhen die Sicherheit.
- Kosten & Effizienz: Follow-ups und Medikamentenpläne werden wirtschaftlicher.
| Einsatz | Beispiel | Grenze |
|---|---|---|
| Chronische Betreuung | Blutdruck- und Diabetes-Management | Notfall mit körperlicher Untersuchung |
| Akutabklärung | Hautausschlag per Video | Unklare Bauchschmerzen |
| Nachsorge | Medikamenten-Check | Neurologische Ausfälle |
Telemedizin in der Versorgungspraxis: Remote Patient Management und Herzinsuffizienz
Remote Patient Management verbindet häusliche Messwerte mit klinischer Bewertung in spezialisierten Zentren. Die direkte Verbindung erlaubt frühe Signale zu erkennen und zeitnah zu reagieren.
Remote Patient Management: Daten aus der Häuslichkeit
Patienten übermitteln regelmäßig daten wie Gewicht, Blutdruck oder implantatbasierte Messwerte. Diese Daten werden strukturiert in Telemedizinzentren bewertet.
Ziel ist die frühzeitige Erkennung von Verschlechterungen bei chronischen erkrankungen und damit die Vermeidung von Notfällen.
Kardiologie im Fokus: Evidenz und Zusammenhang
Die IN‑TIME‑Studie zeigte eine Mortalitätssenkung durch implantatbasiertes Monitoring. TIM‑HF fand keinen generellen Mortalitätseffekt, aber Vorteile nach kürzlicher Hospitalisierung.
Der zusammenhang zwischen Setting und Outcome betont, dass Patientengruppen und Technik entscheidend sind.
Rollen, Therapieanpassung und Rückmeldekanäle
Der arzt vor Ort bleibt primär; ärzten im Zentrum interpretieren daten und geben Therapieimpulse. Rückmeldungen erfolgen per Telefon, App‑Hinweis oder Praxis‑Einbestellung.
Im praktischen beispiel lösen tägliche Gewichtstrends einen Rückruf aus. Diuretika werden angepasst und ein Follow‑up läuft über apps oder eng getaktete Termine.
- Nutzen: Schnellere Reaktion und weniger Klinikaufenthalte für patienten.
- Voraussetzung: Gute Datenqualität, Interoperabilität und Datenschutz.
- Praxis: Klare Alarmregeln, Zuständigkeiten und dokumentierte Entscheidungswege für jeden Fall.
Rechtsrahmen und Compliance: Was Ärztinnen, Ärzte und Plattformen beachten müssen
Rechtliche Leitplanken bestimmen, wie Fernbehandlungen in der Praxis sicher angeboten werden können.
Fernbehandlung als Regelfall
Seit 2018 ist Fernbehandlung nach § 7 Abs. 4 MBO‑Ä zulässig. Die BMV‑Ä Anlage 31c (01.03.2025) macht Video‑Sprechstunden zum Regelfall.
Gleichzeitig bleiben Mindestsprechstunden in der praxis verpflichtend. Das sichert Kontinuität für patient und arzt.
Telearbeitsplatzanforderungen
Ein Telearbeitsplatz muss ein geschlossener Raum sein, telefonisch erreichbar und mit vollem TI-/ePA‑Zugriff ausgestattet.
Der Standort der Tätigkeit muss in Deutschland liegen (§ 8 Abs. 1 und 3). So bleiben Behandlungen rechtssicher.
Werbung, Rx‑Regeln und Apotheken
Werbung für Fernbehandlungen ist nach § 9 HWG möglich, aber mit strengen Vorgaben (BGH 2021, aktuelle OLG‑Entscheidungen).
Werbung für Rx‑Arzneimittel bleibt nach § 10 HWG gegenüber Laien verboten; schon Namen können riskant sein.
Bei Apothekenkooperationen gilt § 11 Abs. 1a ApoG: freie Apothekenwahl ist zu wahren. Der BGH (20.02.2025) erlaubte pauschale Listings unter Auflagen.
Medizinproduktrecht
Software für Diagnose oder Monitoring fällt meist in die MDR‑Klasse IIa. Anbieter brauchen Risikoklassifizierung, klinische Bewertung und Vigilanz.
- To‑do: Compliance-Checks, klare Arbeitsanweisungen und dokumentierte Alarmwege.
- Beratung: Ziehen Sie rechtliche experten und IT‑Sicherheitsfachleute hinzu.
Technische und organisatorische Grundlagen: Infrastruktur, Software und Sicherheit
Sichere Netzwerke, zertifizierte Dienste und klare Verantwortlichkeiten bilden die grundlage moderner Versorgungsprozesse. Diese Basis sorgt dafür, dass digitale Angebote im Alltag funktionieren und rechtskonform bleiben.
Zertifizierte Videodienstanbieter und Datenschutz
Videodienstanbieter müssen nach BMV‑Ä Anlage 31a/31b zertifiziert sein und strenge Datenschutz‑ sowie Datensicherheitsanforderungen erfüllen.
Der Markt wächst schnell: 88 zertifizierte Anbieter (Stand 13.05.2025) gegenüber 43 im September 2024. Mehr Auswahl erhöht die Prüfpflicht für Praxen.
Telearbeitsplatz und nahtlose TI‑Anbindung
Für den einsatz außerhalb des Praxissitzes gelten verbindliche Regeln: geschlossener Raum, telefonische Erreichbarkeit und vollständiger TI‑Zugriff.
Wichtige TI‑Bausteine sind eHBA für Signaturen, Konnektor für die sichere Anbindung und PVS‑Updates für den ePA‑Zugriff. So fließen daten verlässlich in die Akte.
Integration, Sicherheit und organisatorische Abläufe
Apps und Videodienste lassen sich technisch koppeln, wenn Schnittstellen stimmen. SOPs helfen ärzten und MFA, Medienbrüche zu vermeiden.
Sicherheit by Design heißt: Verschlüsselung, Rollenrechte und Protokollierung verpflichtend. Für Telemonitoring sind definierte Schwellenwerte und Alarmkonzepte nötig, damit die überwachung wirkungsvoll bleibt.
Ergebnis: Eine robuste Infrastruktur spart Zeit, reduziert Fehlerquellen und ermöglicht hochwertige leistungen für patienten – ein praktischer Schritt in Richtung verantwortete digitalisierung.
Digitale Booster der Telemedizin: ePA, E‑Rezept und DiGAs im Zusammenspiel
ePA, E‑Rezept und DiGAs bilden ein praktisches Ökosystem, das Daten, Entscheidungen und Alltag verbindet. Die ePA ist die technische Grundlage der TI und liefert Befunde, Medikationspläne und Diagnosen direkt für den Arzt.
Elektronische Patientenakte (ePA)
Die ePA stellt die daten-Grundlage für sichere Therapien. Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeuten können Informationen übertragen, wenn Patientinnen zustimmen.
E‑Rezept seit 2024
Das E‑Rezept ist Standard: Erstellung mit eHBA, Speicherung in der TI und Abruf durch Apotheken. Patientinnen nutzen Token per App, Ausdruck, eGK‑Einlösung oder CardLink. Dispensierinformationen können automatisch in die ePA fließen.
DiGAs und DigiG‑Neuerungen
Im BfArM‑Verzeichnis stehen aktuell 57 DiGAs. Sie erweitern medizinische leistungen, etwa bei chronischen erkrankungen und Verhaltensinterventionen. Das DigiG öffnet den Zugriff für IIb‑Produkte und verlangt Erfolgsmessung sowie erfolgsabhängige Preisanteile.
„Die Verzahnung macht Therapien transparenter und hilft Patientinnen und Patienten im Alltag.“
- Vorteil: Krankenkassen können Versorgung besser steuern und Services über Apps anbieten.
- Praxis‑beispiel: Herzpatient nutzt DiGA‑Coach, E‑Rezept und ePA – der Arzt sieht alle Bausteine und begleitet lückenlos.
Organisation, Markt und Zugang: KBV-Patientenservice 116117 und Portale
Das digitale Vermittlungssystem 116117 bündelt Termine und Sprechstundenangebote für ganz Deutschland.
Nach § 370a SGB V stellt die KBV ein elektronisches System bereit. Fristen regelten den Rollout: telemedizinische Leistungen bis 30.06.2024, Termine bis 30.06.2025.
Termin- und Leistungsvermittlung online
116117.de zeigt transparent Verfügbarkeit, Dringlichkeitsstufen und freie Sprechzeiten. Private Portale können KBV‑Daten gegen Gebühr nutzen (§ 370a Abs. 4 S.1).
Vorteile: Kürzere Wartezeiten, weniger Telefonaufwand für die praxis und eine strukturierte Zuweisung nach medizinischer Priorität.
Information und Dialog: Rolle von Krankenkassen und AOK‑Angeboten
Das nationale Portal gesund.bund.de liefert allgemein verständliche informationen für Patientinnen und Patienten. Krankenkassen bauen ihre Services aus und entlasten so ärzte bei Routinefragen.
Die AOK‑Publikation „PRO DIALOG“ liefert alle 14 Tage experten‑Einblicke für ärzte und Praxisteams. Newsletter halten den Kontakt mit Neuerungen leicht zugänglich.
- Wie patienten schneller die richtigen leistungen finden: 116117 bündelt Angebote kostenfrei und nach Dringlichkeit.
- Wettbewerb: Private Portale bieten zusätzliche Usability‑Möglichkeiten, bleiben aber an Gebührenregelungen gebunden.
- Praktische Tipps: Praxisprofile aktuell halten, Sprechzeiten klar kommunizieren und Kontaktwege bündeln für besseren Patientenkontakt.
Fazit
Kurzfassung: Der kombinierte Einsatz digitaler Angebote stärkt die Versorgung und die gesundheitsversorgung vor Ort. Gut gestaltete Prozesse beschleunigen Entscheidungen und sichern Kontinuität.
Für arzt und Team gilt: Standardisieren Sie Abläufe, halten Sie Technik stabil und achten Sie auf Compliance. So entfalten telemedizine Leistungen ihr volles Potenzial.
Die Beziehung arzt patient bleibt zentral. Digitale Booster wie ePA, E‑Rezept und DiGA machen telemedizinischer leistungen transparenter und helfen patienten, Therapiepfade zu verstehen — besonders bei chronischen erkrankungen.
Organisation, Portale und der 116117‑Service verkürzen Zugänge. Wer Prioritäten setzt, Teams schult und Kennzahlen definiert, schafft verlässliche Strukturen für ärzte, ärztenetze und patienten — auch aus der ferne.